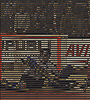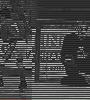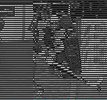| Gelenkigkeit ist die Fähigkeit,
willkürliche Bewegungen mit einer großen Schwingungsweite in bestimmten
Gelenken auszuführen. Für Gelenkigkeit verwendet man auch die
Begriffe Beweglichkeit und Flexibilität. Ihr Maßstab ist jeweils der
maximale Bewegungsausschlag (-amplitude); für Messungen kann in statische
und dynamische Gelenkigkeit differenziert werden. Für die Praxis unterscheidet
man in:
-Allgemeine Gelenkigkeit: im Alltagsleben (normaler Umfang in
der Schwingungsweite).
-Spezielle Gelenkigkeit: für bestimmte Disziplinen
(Hürdenlauf, Turnen usw.).
-Aktive Gelenkigkeit: wird durch innere
Muskelkräfte hervorgerufen (z. B. selbständig ausgeführte, Rumpfbeuge
vorwärts) und ist im allgemeinen kleiner als die passive Gelenkigkeit.
-Passive
Gelenkigkeit: wird durch Einwirkung äußerer Kräfte erreicht (z.
B. Rumpfbeugen vorwärts mit Partnerunterstützung oder eigenem Körpergewicht).
Leistungsbestimmend und -begrenzend wirken -anatomische und
biomechanische Zusammenhänge,
-muskel- und neurophysiologische Bedingtheiten
(z.B. Elastizität, tonischer Spannung, inter- und intramuskuläre Koordination),
-altersbedingte Entwicklung,
-psychische Verfassung (z. B. emotionale
Erregung),
-Umwelteinflüsse (z.B. Temperatur, Tageszeit),
-Training
und Übungsgrad,
-Ermüdung,
-Aufwärmen. Aufgrund
dieser leistungsbestimmenden Komponenten ist die Gelenkigkeit stark von motorisch-koordinativen
Bedingtheiten geprägt. Gelenkigkeit ist eine elementare Voraussetzung
für technisch und konditionell gute Bewegungsausführungen. Ungenügend
ausgebildete Gelenkigkeit kann im Sport folgendes bewirken:
- Verletzungsgefahr
ist größer
- Neue Bewegungen werden schlechter erlernt
- Krafteinsätze
sind z.T. "behindert", somit unökonomisches Arbeiten
- Qualität
der technischen Ausführungen leidet (z.B. kürzere Schritte, weniger
Schwung, Rhythmusbehinderungen). 
|